
Keine Anna selbdritt, aber eine Trias nicht nur glücklicher Verwandter: Edvin Revazov als Tennessee Williams hält Patricia Frida als Amanda und Alina Cojocaru als Laura Rose in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier. Foto: Kiran West vom Hamburg Ballett
Es ist ein phänomenal intensives Ballettkammerspiel, mit dem John Neumeier am gestrigen Sonntagabend in der Hamburgischen Staatsoper überraschte: die umjubelte Uraufführung seines neuen Stücks „Die Glasmenagerie“ birgt simple, aber umso nachhaltigere neue theatrale Effekte, jenseits von schnöder Kulissenschieberei. Ganze Labyrinthe von imaginierten Weltenfluchten werden hierin fasslich; die Kraft der Fantasie und der Poesie manifestiert sich teilweise in einer ganz neuen Art von Bewegungstheater. Tennessee Williams, der schwule amerikanische Dramatiker und Poet, gab mit seinem gleichnamigen Theaterstück von 1944 den Anstoß. Dieses Stück hatte Neumeier als 17-Jähriger am Universitätstheater in Milwaukee gesehen, kurz bevor er dort Student wurde. Der begabte Regisseur war Neumeiers späterer Mentor, Father John Welsh, ein Jesuit. Und jetzt hat Neumeier (mittlerweile, man glaubt es kaum, 80 Jahre jung) seine ganz eigene Interpretation des Stücks mit den Mitteln des Tanztheaters entworfen. Mit Bravour bewältigt er dabei auch Themen, die sonst eher nicht zum Katalog tanzaffiner Stoffe gehören, wie Behinderung und Arbeitswelt, Schwulenbar und Schreibmaschinenkurs. Das Hamburg Ballett hat somit die Ehre, ein ganz und gar untypisches abendfüllendes Tanzstück zu zeigen: Es ist puristisch reduziert auf das Wesentliche, verschmäht jeglichen Protz, setzt ganz auf die Dichte von Emotion und Situation.
Stummes Schauspiel und langsam-laszive Tänze in Kombination mit hochakrobatischen, blitzschnell ausgeführten körperlichen Raffinessen – diese Mischung hält in Atem.
Coach Ivan Urban hat zudem mit den Solisten und dem Ensemble präzise und dennoch betont melodiös an den Bewegungen gefeilt. Bravo!
Dass die Szenen fließend in einander übergehen, kennzeichnet das Stück als moderne Collage.
Und obwohl die ganze Bühne genutzt wird, entsteht immer wieder der Eindruck eines intimen Rahmens, eben eines Kammerspiels, das schneller unter die Haut geht als man es bemerken kann.

Tennessee Williams, getanzt von Edvin Revazov, zu Beginn der „Glasmenagerie“ von John Neumeier beim Hamburg Ballett. Rechts zeichnet das Kind Tom (Andrej Urban). Foto: Kiran West
Bühnenbild (Mitarbeit: Heinrich Tröger), Licht und Kostüme schuf ebenfalls Neumeier, und nur eine Filmprojektion in Schwarz-weiß, die ein abstrakt anmutendes All mit Nebelschwaden zeigt – womit der entfernt stattfindende Zweite Weltkrieg gemeint ist – stammt vom Hausfotografen Kiran West. Alles ist symbolisch verknappt, nichts ufert aus: Weniger ist mehr, scheint hier die Losung.
Ein Teil des Publikums wird vermutlich erstaunt sein, ausgerechnet von Neumeier, der ein Großmeister der effektvollen, auch pompösen Grandezza ist, ein so subtiles Auffächern innerer Werte zu sehen. Aber jeder, der die Werke des Hamburger Genie gut kennt, wird begeistert bemerken, dass sich hier der Kern, die Essenz von Neumeiers künstlerischen Absichten konzentriert darbietet.
Dabei haben Choreograf und Dramatiker, also John Neumeier und Tennessee Williams, persönlich nicht das beste Verhältnis gehabt. Als Neumeier vor etlichen Jahrzehnten in den USA anfragte, um die Lizenz für sein erstes Williams-Ballett, die „Endstation Sehnsucht“, zu erhalten, bekam er eine Absage. Williams hatte die Exklusiv-Rechte an eine eher unbekannte Choreografin vergeben und sah sich nicht in der Lage, daran etwas zu ändern. Erst seine Erben waren, nachdem der 1911 geborene Williams 1983 einen mysteriösen Erstickungstod durch den Verschluss eines Medizinfläschchen erlitt, verhandlungsbereit.
Neumeier zögerte nicht. Noch im selben Jahr, 1983, wurde beim Stuttgarter Ballett sein furioses Ballett-Theater „Endstation Sehnsucht“ uraufgeführt, und jeder, der es kennt, weiß, dass Neumeier Recht hat, wenn er sagt, dass er hierin eine neue strukturelle dramatische Form entwickelt hatte.
Offenbar bringt Williams Neumeier immer in dieser Hinsicht voran.
Das liegt womöglich an den vielen Fragen, die seine Dramen aufwerfen.

Keine Sekunde Langweile während der zweieinhalb Stunden Aufführungszeit inklusive Pause: Auch das Programmheft zeigt, wie abwechslungsreich die Szenen von „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier beim Hamburg Ballett sind. Foto: Kiran West
„The unanswered question“, die nicht beantwortete Frage – so heißt auch das erste Musikstück in Neumeiers „Glasmenagerie“, und es stammt von Charles Ives.
Simon Hewett bringt die Partitur mit dem Philharmonischen Staatsorchester mit meditativer Eindringlichkeit auf den Punkt.
Ein langer, zäher Ton erklingt. Die Atmosphäre ist entrückt. Es ist eine Traumwelt, die wir sehen und hören, von Anfang an.
Wer das Libretto liest, weiß, wieso:
Der Zauber der Erinnerung verleiht hier allem seinen nebligen Schleier und doch auch seine unbarmherzige Klarsicht.
Das Stück beginnt mit der Kindheit. Wir sehen den süßen Jungen Tom (Andrej Urban) und das niedliche Mädchen Laura Rose (Emilia Koleva) – sowie ihr afroamerikanisches Kindermädchen Ozzie (Stacey Denham), das bevorzugt „Gespenst“ mit den Kids spielt, sich also ein Bettlaken überstülpt.
Welche Freude, wenn das Laken im hitzigen Spiel heruntergeholt wird!
Doch dann schaut man auf den gut aussehenden, sich wie in Zeitlupe, so sacht und vorsichtig bewegenden Mann in der Szenerie im hinteren linken Teil der Bühne. Eine im Kippen stehen gebliebene Zimmerwand deutet dort die prekäre Situation der Menschen an, die hier leben.
Der gut aussehende Tänzer in einem Mantel steht neben einem weiteren Tänzer im karierten Hemd. Das sind nun zwei bildschöne Männer mit schwarzem Haar – und doch stellen sie ein- und dieselbe Person dar. Es sind der Dichter und sein Alter ego.

Eine Familie, die nicht intakt ist – mit Tennessee Williams (stehend), der sich an sie erinnert. So zu sehen in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier. Foto: Kiran West
Während der Proben hießen noch beide Tom Wingfield, Neumeier hatte sie Tom I und Tom II genannt. Mittlerweile hat sich das verändert: Der Eine, der Mann im Mantel, ist Tennessee Williams, der sich an seine Jugend erinnert, während der Andere, im karierten Hemd, sein Protagonist Tom ist, der Sohn der Familie, die Williams für sein Stück „Die Glasmenagerie“ frei nach der eigenen Autobiografie erfand.
Es ist dieser raffinierte Kunstgriff, der dem Ballettdoyen John Neumeier das Illusionsspiel aus Schöpfersicht in seiner jüngsten Kreation erlaubt. Und so tanzt der souverän-lässige Edvin Revazov den Dichter Tennessee, während Félix Paquet mit katzenhafter Geschmeidigkeit dessen Protagonisten Tom darstellt.
Verwirrend poetisch ist diese Konstellation, wobei die Hauptperson noch eine andere ist – und weiblich.

Versonnen und willensstark: Alina Cojocaru als Laura Rose in John Neumeiers Ballettkammerspiel „Die Glasmenagerie“ beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West
Das Stück erzählt nämlich die Lebens- und Leidenserfahrungen von Toms Schwester Laura Rose, virtuos getanzt und gehumpelt – jawohl: gehumpelt – von Alina Cojocaru.
Diese Londoner Weltballerina rumänischer Herkunft, die Neumeier schon zu Höhenflügen wie für „Liliom“ anregte, zeigt jetzt einen neuen Höhepunkt ihres Könnens. In der „Glasmenagerie“ tanzt sie die Hauptfigur namens Laura Rose, eine gehbehinderte Seelenverwandte der Schwester von Tennessee Williams.
Ein Ballett über eine Gehbehinderte als Hauptgestalt zu realisieren, ist sicher keine leichte Aufgabe. Aber so fantasievoll, wie Neumeier seinen Star hier auftanzen lässt, gibt es keinen Zweifel: Das ist ein Aufgabenfeld für sich, eines mit Zukunft, denn der Abbau von Tabus in der Kunst sollte ein allgemeines Ziel werden.
So fantasievoll und delikat hier die Soli, Pas de deux, Pas de trois und Pas de quatre von Laura Rose entworfen sind, so unabdingbar macht John Neumeier damit klar: Auch Behinderte haben das Recht auf Ästhetik und Moral, auf Träume von Schönheit und Glück, von Liebe und Begehren, von Frieden und Gerechtigkeit.
Laura Rose trägt jeweils einen Spitzenschuh und einen Absatzschuh, und damit humpelt sie automatisch, wenn sie geht. Manchmal benutzt sie zusätzlich eine Krücke. Aber auch Zehenspitzentanz zelebriert sie mit dieser Behinderung, und ihre Dehnungen in den Luftspagat erhalten durch die beiden verschiedenen Füße eine zusätzliche Schönheit.

Der Spagat in einer seiner schönsten Formen: zu sehen in „Die Glasmenagerie“ in den Paartänzen von Alina Cojocaru als Laura Rose und David Rodriguez als Einhorn mit Cambré während der Hebung in der choreografischen Obhut von John Neumeier. Foto: Kiran West
Allein die vielen verschiedenen Variationen von Bewegungen im Spagat, die Cojocaru mit ihren verschiedenen Tanzpartnern hier zu absolvieren hat, sind köstliche Beweise für die nach wie vor ungebrochene hochkarätige Schaffenskraft Neumeiers.
Es dürfte keine andere Choreografie geben, in der so nonchalant so viele ausdrucksstarke, ästhetische Neukreationen von Figuren mit Damenspagat eingebracht worden sind.
Es ist fantastisch. Waagerecht, hochkant, seitlich, als Drehung in jeder nur möglichen Position, als spiralisierte Hebung, als Lift mit Winkelveränderung, als Entwicklung aus dem Developpé, aus der Hocke, aus der Arabeske, aus der Attitude – Alina Cojocaru verleiht der behinderten Laura Rose durch die Schönheit ihrer schnurgerade gespreizten, elegant ausgestreckten Beine und Füße den Nimbus absoluter Erhabenheit.
Das wirkt nicht artifiziell oder aufgesetzt, sondern ganz natürlich, es ist in den anderen – auch humpelnden – Bewegungsfluss integriert.
Damit hat John Neumeier wie nebenbei allen körperlich schwachen, erkrankten oder behinderten Frauen ein Denkmal gesetzt, und die Vereine, die sich weiblichen Behinderten widmen, sollten ihm dafür einen Orden oder eine Ehrung zukommen lassen.

Vorn rechts der durch einen Absatzschuh behinderte Fuß von Laura Rose, brillant getanzt von Alina Cojocaru. Yun-Su Park stellt hier die Lehrerin für das Fach Schreibmaschine in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier beim Hamburg Ballett dar. Foto: Kiran West
Zudem hat Neumeier das Ballett jener Dame namens Joan gewidmet, die er als Teenager in der Rolle der Laura im Universitätstheater sah und mit der Zeit ihres Lebens befreundet war, auch, als sie aufgrund einer Behinderung im Rollstuhl saß.
Tanzwissenschaftlich ergibt sich außerdem Folgendes:
Wenn man bedenkt, dass John Cranko, jener Stuttgarter Choreograf und Begründer des „Stuttgarter Ballettwunders“, der sozusagen einer der Vorläufer von John Neumeier war (Neumeier war auch Tänzer bei Cranko), den majestätischen Spagatsprung („Grand jeté“) demokratisierte, indem er ihn zu einem prägnanten seriellen Synchronsprung des Corps de ballet der Damen machte (in „Onegin“), so hat Neumeier nun den Spagat aus dem üblichen Bewegungsrepertoire der Brillanz herausgenommen und zu einer Hommage für die Rechte der Benachteiligten gekürt.
Als Leitmotiv erfüllt der Spagat hier in den Hebefiguren den Inhalt des Zitats: das tapfere „Ich kann“, das unbeugsame „Ich liebe“, das hartnäckige „Ich werde“ spiegeln sich darin.
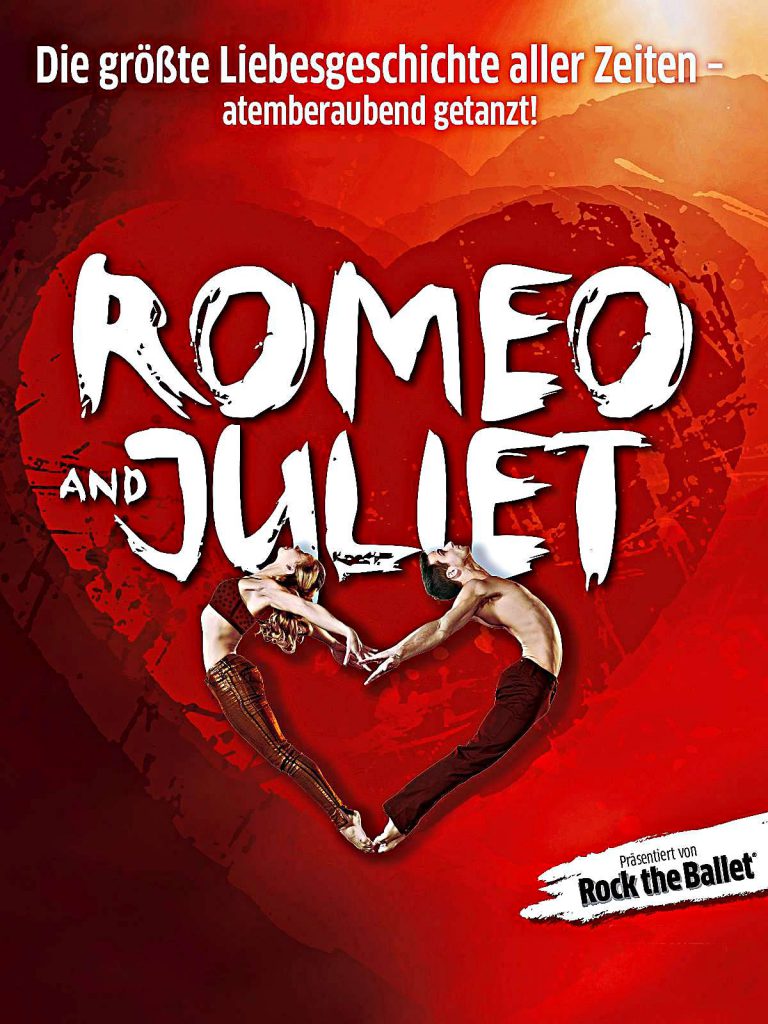
„Romeo and Juliet“ – das ist ein Kontrastprogramm zu traditionellen Ballettabenden, mit der vollen Energie ausgewählter Spitzentänzer und dem Temperament rockiger Balladen. Die berühmte Liebesgeschichte von William Shakespeare findet hier zu Pop- und Rockmusik statt, mit Hits von Megastars wie Lady Gaga und David Guetta. Ballett trifft auf Jazzdance, auf HipHop und auf Akrobatik – und das auch an Silvester 2019 und ist nur in Köln – vom 25.12.19 bis zum 5.1.2020 – zu erleben! Hier gibt es außerdem weitere Infos und die Tickets. Foto: Anzeige
Cojocaru tanzt allerdings auch, als sei ihr die neue Körperlichkeit nicht im mindesten fremd. Es ist großartig, wie sie sich in die Rolle der schüchtern-entrückten, aber auch sinnlich-verträumten Laura Rose einfühlt. All ihre Vorstellungen von Harmonie und menschlicher Wärme, von Zusammenhalt und Partnerschaft kann sie nur in ihrer Fantasie erleben. Aber das macht sie mit einer Wucht, einer erotischen Sensitivität, einer Willensstärke, die einen auch als Zuschauer aufleben lässt.
Auch das ist Glück, anstelle von nur routiniertem Leben…
Die ärmlichen Verhältnisse, unter denen Laura Rose lebt, verhindern zudem im hartherzigen Amerika der 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts jede selbständige Tatkraft, jeden Aufbruch in ein eigenes Dasein für alleinstehende Frauen.
Tennessee Williams hat das genau erkannt: Die Falle, in der Frauen im Patriarchat sitzen, wenn sie nicht in eine Versorgungsehe kommen können oder wollen.
Und so träumt sich Laura Rose, die zudem eine Seelenverwandte der Schwester von Tennessee Williams ist, aus der Enge und Armut ihrer Familie in eine Welt der Harmonie.
Hilfreich dabei: ihre Sammlung von Glastieren, daher auch der Titel „Glasmenagerie“.
Auf einer Art Teewagen stehen die Tierchen vorn links an der Rampe, und wenn das Licht drauffällt, glitzern sie verheißungsvoll.

David Rodriguez als Einhorn tanzt mit der träumenden Laura Rose alias Alina Cojocaru in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier. Foto: Kiran West
Tanzt Laura Rose mit ihnen, erscheint das Einhorn, ihr Lieblingstier, als Mann in Weiß (ultra-elegant: David Rodriguez, der somit ein Rollenprofil kreiert hat, das zu ihm passt und seinen starken, anmutigen Körper mit der Aura des Überirdischen anfüllt).
Mit modern-energetischen Paartänzen voll akrobatischer Delikatesse entfaltet sich dann das Gefühl von menschlicher Wärme und Solidarität – etwas, das im realen Amerika der 40er-Jahre viel zu selten zu haben war.
Für Laura Rose ist dieser Tanz mit dem Einhorn lebenswichtig, und auch am Ende, als sie alles verloren hat, alle weiteren Hoffnungen, ist es dieser Tanz, der ihr die Kraft gibt, weiterzumachen.
Es ist verblüffend und auch beschämend für diese Gesellschaft, wenn man bedenkt, dass alleinstehende Frauen ohne Herkunft aus dem Geldadel auch heute noch massiv abgewertet und im sozialen Aufstieg unterdrückt werden. Und das, obwohl wir seit August 2008 ein Anti-Diskriminierungsgesetz und seit Oktober 2017 die Me-too-Bewegung haben.
Alleinstehende, von Armut betroffene und behinderte Frauen haben sogar ein dreifaches Stigma zu bewältigen – Frauen wie Laura Rose, die über ihren Kummer weder bösartig noch depressiv werden, sind darum Heldinnen.
Für Tennessee Williams war es aber auch eine Art der Wiedergutmachung, „Die Glasmenagerie“ zu schreiben. Denn das Modell aus der Wirklichkeit, das er zur Vorlage für seine Laura nahm, war Rose, seine Schwester.
Es gibt Fotos aus der Kindheit von Williams, und diese zeigen, dass sowohl die Mutter als auch die Schwester eine sehr angenehme Ausstrahlung hatten.
Auch Williams selbst scheint ein ausnehmend hübsches Kind gewesen zu sein.
Vor allem aber verband die drei wohl ein Band der Liebe, das nachgerade musterhaft eine familiäre Idylle abgab.
Williams‘ Vater war zwar viel auf Reisen, ließ die Familie aber finanziell nicht im Stich, wie es der Vater in „Die Glasmenagerie“ tat.
Das in Chicago uraufgeführte Stück war der erste große Erfolg des später weltberühmten Tennessee Williams.
Das Programmheft vom Hamburg Ballett weist darauf hin, dass der Erfolg des Stückes vor allem einer einzigen Kritikerin namens Claudia Cassidy zu verdanken war. Interessanterweise hat dieselbe Cassidy auch John Neumeier als Tänzer entdeckt, insofern, als er ihr bei seinem ersten professionellen Auftritt positiv auffiel, obwohl er keine Hauptrolle tanzte.
Nein, ich bin keine Verwandte und auch keine Reinkarnation von Claudia Cassidy, die 1996 verstarb und die wegen ihrer spitzen Zunge auch spaßhaft „Acidy Cassidy“ („Ätzende Cassidy“) genannt wurde: Schlechte künstlerische Leistungen strafte sie nämlich ebenso rigoros verbal ab, wie sie hohe Leistungen herausstellte. Es ist ja auch die Aufgabe von uns Kritikern, das zu tun – nach bestem Wissen und Gewissen. Inwieweit beides jeweils individuell ausgebildet ist, mag derweil dahingestellt sein, aber das gilt für Künstler nun ganz sicher auch.
Dennoch muss ich betonen, dass John Neumeier mit seinem neuen Werk „Die Glasmenagerie“ einen mutigen Schritt in den avantgardistischen Bereich wagt, der vermutlich nicht von allen auf Anhieb verstanden und genossen wird.

Ein Traumpaar und dennoch in der Realität ohne Chance: Christopher Evans als Jim und Alina Cojocaru als Laura Rose in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier. Foto: Kiran West
Dazu trägt auch die Musikauswahl bei.
Außer dem eingängig-monotonen Philip Glass, der als Bühnenkomponist in Deutschland bereits sehr beliebt ist, außer dem absurd quirligen Quintett Bright Music von Ned Rorem und außer Swing und Jazz, der von köstlich knisternden alten Platten kommt, bringt Neumeier uns hier einen seiner ganz großen amerikanischen Landsleute nahe:
Charles Ives (1874 – 1954) ist einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, und er ist wohl der bedeutendste unter denen, die die USA hervorbrachte. (Sorry, aber da können Bob Dylan und Johnny Cash noch so viele Millionen Dollars gemacht haben: Gegen Ives sind sie musikalische Anfänger geblieben, Pop und E-Musik hin oder her, man muss da nicht unterscheiden.)
Ives – den Zwölftonmusikern nahe -war ein Pionier in jeder Hinsicht. Er schimpfte auf Flugzeuge, weil er die Vögel nicht mehr singen hörte, wenn der Fluglärm die Atmosphäre akustisch verschmutzt, und er verachtete oberflächliche Auszeichnungen für Künstler, weil er befand, dass Werke für sich selbst stehen müssten.
Man muss dazu sagen, dass er – im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern – das Privileg hatte, finanziell unabhängig zu sein. Der Grund dafür ist ebenfalls eine Seltenheit: Der Tonkünstler agierte an der Wall Street mit einem eigenen großen Unternehmen.
Fraglich, ob das heute noch möglich wäre: Ein Künstler, der im Nebenberuf sein Geld mit etwas ganz Profanem an der Börse macht… Heute verlangt der eine wie der andere Beruf die volle Kraft, die totale Aufmerksamkeit eines Menschen und frisst ihn eher auf, als dass er ihm noch Platz für eine eigentliche zweite Existenz ließe.
Die verheerende sozialpolitische Bedeutung des Börsenmarktes dürfte Ives im übrigen nicht klar gewesen sein, sie hat ihn vielleicht auch nicht interessiert. Den großen Boom des globalen Marktes mit seinen Entscheidungen im Hinblick auf Börsenprofite statt auf Warenproduktionen hat er auch nicht mehr erlebt.
Was ihn aber interessiert hat, waren logisch-philosophische Zusammenhänge.
„Eine beantwortete Frage beendet Bewegung mit Stillstand. Eine unbeantwortete Frage treibt einen voran“ – das war sein Credo, und darum heißt das Eingangsstück zu Neumeiers „Glasmenagerie“ eben auch „The unanswered question“.

Félix Paquet als Tom Wingfield in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier: Ein junger Mann, der seine Träume verwirklichen will. Foto vom Hamburg Ballett: Kiran West
Vieles an seinen Kompositionen klingt schräg und schief, unerwartet und ermüdend. Aber das ist nur der oberflächliche Anschein. Konzentriert man sich und hört genau zu, entdeckt man Schönheit und Melodie in den musikalischen Phrasen, und sein Einsatz von Trompeten ist nachgerade legendär, was auch in der „Glasmenagerie“ zu hören ist. Ives macht aus Trompeten nämlich Engelsstimmen.
Auch für Tennessee Williams gibt es übrigens etwas, das nur bei ihm zu finden ist: Der Versrhythmus des Trochäus prägt nicht nur seine Lyrik, sondern auch sein dramatisches Werk. Seine Gedichte bergen Witz und Vielschichtigkeit in prägnant einfacher Form, leider sind sie derzeit in keiner deutschen Übersetzung auf dem Buchmarkt. Die amerikanische Ausgabe seiner gesammelten Gedichte bei New Collections Book (New York) ist aber unbedingt empfehlenswert, zumal sie mit einer CD gelesener Gedichte als Bonus aufwartet.
Der Trochäus ist, wenn man so will, besonders aufrüttelnd und penetrant. Während der Jambus lyrisch und reflektiert wirkt und die beiden anderen klassischen Versmaße auf Behauptung (Daktylus) und Alarm (Anapäst) abstellen.

Alina Cojocaru im Rollenportrait der Laura Rose – so zu sehen im Programmheft vom Hamburg Ballett für „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier, fotografiert von Kiran West. Faksimile: Gisela Sonnenburg
Ein Poem entstand schon 1937 für Williams‘ Schwester Rose:
„She is a metal forged by love / too volatile, too fiery thin“, so beginnt es, übersetzt heißt es in etwa: „Sie ist ein von Liebe geschmiedetes Metall / zu flatterhaft und zu feurig schmal“.
Ihre Schönheit nutzte Rose nämlich nichts, sie wurde als schizophren eingestuft und in Abwesenheit ihres Bruders stimmten ihre Eltern einer Lobotomie zu.
Diese menschenrechtsverletzende Operation besteht darin, einen Teil des Gehirns zu entfernden. Man war damals in der Tat stolz darauf, psychisch Auffällige durch solche Eingriffe lebenslang (und irreparabel) ruhig zu stellen.
Rose Williams überlebte Tennessee übrigens, allerdings als Dauerinsassin einer Klinik.
Den Aspekt psychischer Erkrankung hat Neumeier nicht in seine „Glasmenagerie“ mit einbezogen. Inwieweit die Diagnose Schizophrenie bei Rose nun stimmte oder nicht, ist aus heutiger Sicht ohnehin nicht mehr zu entscheiden, schon weil die Lobotomie Rose jede Möglichkeit, sich normal zu entfalten, nahm.
Als Jugendliche hatten Rose und Tennessee eine sehr innige Beziehung. Sie statteten Roses Zimmer mit weiß getünchten Möbeln aus und platzierten Glastiere darin. Die Glasmenagerie gab es also einmal ganz real – und die Träume, die das Funkeln der Kristalle in den Herzen der jungen Leute auslöste, ebenfalls.
Bei Neumeier hütet Laura Rose zusätzlich noch einen Kristallanhänger, den ihr Ozzie, das Kindermädchen, schenkte.
Die Vermengung von Hoffnung und Tragik ist fester Bestandteil des Neumeier’schen Werks.
1984 choreografierte er die „Sechste Sinfonie von Gustav Mahler“ (die auch „Die Tragische“ genannt wird), und während der Arbeit an der „Glasmenagerie“ in diesem Jahr, also 2019, stellte er fest: „Interessanterweise erkenne ich den 3. Satz aus der ‚Sechsten Sinfonie von Gustav Mahler‘ nun als eine unbewusste Vorskizze für ‚Die Glasmenagerie‘.“
Dabei geht es vor allem um die Idee, einen Kinosaal zum Ausgangspunkt für erotische Träumerei zu nehmen. Mehr dazu im Bericht hier über die entsprechende Ballett-Werkstatt.
Die Tänze, die die Familienmitglieder bei Neumeier mit Tennessee vollführen, sind zudem von jener Sehnsucht nach Halt und Gemeinsamkeit erfüllt, die Neumeier auch in ein anderes seiner Ballette über die USA einbrachte:

Sie stehen eng beisammen, aber im Grunde möchten alle fort: Standbild mit Symbolgehalt in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West
In „The Age of Anxiety“ von 1979 nach dem gleichnamigen Versdrama von W. H. Auden (und zu Musik von Leonard Bernstein) faszinieren ebenfalls eng beisammen stehende Figuren, deren Körper Skulpturen zu bilden scheinen: aufrecht stehend oder sich biegend, wie im Reigen oder wie im Sturm komponiert.
Dieses Miteinander trifft eine ganz bestimmte Atmosphäre menschlichen Miteinanders, das doch vor allem ein Streben nach etwas anderem ist. Es ist vielleicht eine verkappte Form der Einsamkeit, die sich so äußert: eine Einsamkeit, die zugleich ein großes Gefühl von Offenheit und Freiheitsdrang bedeutet und die das Gegenteil von Herdentrieb und Anpassung ist. Weshalb sie sich gerade in der Gruppe äußert.
Auch Tennessee Williams und eben Auden hatten erkannt, dass die Einsamkeit das große vorherrschende Gefühl vieler Menschen in den USAi st. Die ständige Gefahr, sozial abzustürzen, lässt, äußerlich gesehen, zwar eng zusammenrücken. Aber aus der Innenansicht verstärkt sie die Bedrückung, die Isolation, die Vereinsamung.
Davon erzählen auch Williams‘ Dramen.

Der Mensch wird abgerichtet: Schreibmaschinenkurs mit dem hervorragenden Damencorps vom Hamburg Ballett in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier. Foto: Kiran West
Die Wirkungskraft der „Glasmenagerie“, die eines der ersten Psychodramen überhaupt war, war im übrigen rasch international und reichte auch hinter den Eisernen Vorhang.
In der DDR wurde das Drama 1964 von Lothar Bellag verfilmt, 1973 folgte eine Verfilmung in den USA mit Katherine Hepburn in der Hauptrolle.
Stets geht es dabei vor allem um die herben Enttäuschungen, die der kapitalistische Alltag für die Menschen bereit hält.
Die Frauen sind darin angewiesen auf einen männlichen Versorger.
Doch Lauras Familie – mit Nachnamen Wingfield, also „Flügelfeld“ – wurde vom Vater verlassen. Darum muss Tom, der eigentlich Schriftsteller werden will, als Lagerarbeiter seine Mutter und Schwester über Wasser halten.
In Neumeiers Ballett will Tom nicht Dichter, sondern Kunstmaler werden. Ein Zeichenblock ist darum sein ständiges Requisit, um das es mit der Mutter Amanda (melancholisch verhärmt: Patricia Friza) denn auch häufig Streit gibt. Man könnte sich übrigens auch Silvia Azzoni vom Hamburg Ballett ganz hervorragend in der Partie der Amanda vorstellen.
Und: Tom ist schwul. In einer Bar nur für Männer macht er erste Erfahrungen. Sein Kumpel Jim allerdings, mitreißend sportlich und doch wie schwebend getanzt von Christopher Evans, hat eine Verlobte. Das bekümmert nicht nur Tom. Denn auch Rose ist in Jim verliebt.

Tom (Félix Paquet) lässt sich vom Barman Malvolio (Marc Jubete) verführen. So zu sehen in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West
Zunächst aber geht es um den Arbeitsalltag und seine für kreative Menschen erbarmungslose Stupidität.
Neumeier lässt Félix Paquet als Tom und dessen Kollegen vom Corps de ballet schlichtweg mit Schuhkartons tanzen.
Ganz unspektakulär und doch wirkungsstark ist diese Szene, an deren Ende Tom sich gegen den Lagerarbeitswahn auflehnt.
Es ist und bleibt ja ein Grundproblem unserer Gesellschaft, dass Menschen in Jobs gedrückt werden, die ihnen womöglich gar nicht liegen, während sie das, was sie besser als andere können, nicht ausüben oder gar nicht erst erlernen dürfen.

Tom (wunderbar tapfer: Félix Paquet) schafft den Absprung aus der Schuhfabrik. So zu sehen in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier beim Hamburg Ballett. Foto: Kiran West
Hier hat die Demokratie zweifelsohne Nachholebedarf. Die Talente und Neigungen eines Menschen sollten ebenso wie seine Schwachstellen und Mängel berücksichtigt werden, wenn es heißt: Bitte halten Sie sich für den Arbeitsmarkt zur Verfügung.
Damit könnte man viel Leid und Unzufriedenheit verhindern und dafür positive Kräfte in die Arbeitsprozesse einbinden.
Auch jene Szene, in der Laura Rose sich in einem Schreibmaschinenkurs versucht, ist hier aufschlussreich. Neumeier gelingt es, das Heer der tippenden jungen Damen zugleich als Ermahnung vor der entfremdeten Arbeit zu inszenieren. Immer nur fremde Gedanken weiterzugeben, ist nicht jedermanns – jeder Frau – gute Sache.
Als Gegenwelt dienen die Träume der handelnden Personen.
Mutter Amanda träumt von ihren Gentleman Callers, die sie einst, als sie noch das verwöhnte Südstaaten-Mädel war, scharenweise um sie buhlten.
Tom träumt von Männerliebe, vom Zeichnen, von der Freiheit.
Laura Rose träumt von Liebe, Harmonie, Zusammenhalt – etwas, das für sie unerschwinglich ist.
In Williams‘ Drama ist Amanda nicht nur eine abgehärmte Melancholikerin, wie bei Neumeier, sondern auch eine Tyrannin. Sie schlägt Tom mit den gleichen Mitteln in die Flucht, mit denen sie ihn zu disziplinieren sucht. Sie will ihn als Versorger für sich und Laura unterjochen, zugleich will sie ihn als untertäniges Kind bei sich behalten.
Im Ballett ist es so, dass Tom sich vor allem durch sein Coming out insofern von der Familie freimacht, als er erkennt, dass er sein Glück nur bekommt, wenn er auszieht.
Es gibt eine entzückende Szene, in der er mit Jim flirtet, ihn in eine Nijinsky-Pose setzt und ihn so zeichnet. Auch tänzerisch kommen sich die beiden körperlich sehr nahe.
Aber statt zu küssen, ergreift Jim die Flucht.

Die erste Erfahrung in Sachen Sex ist nicht unkompliziert: Félix Paquet als Jim und Marc Jubete als Barman (auf ihm) in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier. Foto: Kiran West
Tom sucht daraufhin seine ersten Erfahrungen mit Männern in einer Bar, „Malvolio’s Magic Bar“. Und es ist keineswegs einfach und nur toll, was ihm hier passiert. In der Atmosphäre von Promiskuität und sexuellem Beutefang wird er der Passive, der sich auch in erotischer Hinsicht nicht nur sanft belehren lassen muss. Schießlich aber findet er, was er sucht – und kommt glücklich, erschöpft und ein wenig betrunken nachhause.
Dass er Rose von seinem sexuellen Erlebnis tänzerisch erzählt, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Sie versteht ihn auch ohne Eindeutigkeit und genießt es, das gelbe Tuch, das er aus der Bar mitbrachte, auf ihrem Gesicht zu spüren.
Sie selbst hat viel weniger Möglichkeiten, sich sexuell zu verwirklichen.
Wenn sie ins Kino geht – hier sitzt sie dann mit einigen Anderen vor einer transparenten Leinwand – so erträumt sie sich, dass Jim und sie in einem Pas de deux voller exquisiter Hebungen und auch Spannungen ein Leben zu zweit beginnen.
Dieser Pas de deux gehört zu den Höhepunkten des Balletts, auch wenn er die Handlung hier nicht voran bringt.
Als retardierendes Moment hält er vielmehr den unausweichlichen Fortgang der Geschichte auf. Aber: Er illustriert all die poetisch-erotischen Kräfte, die in Laura Rose schlummern.
Alina Cojocaru und Christopher Evans sind ein wunderbares Paar für diese Szene. Sie lässt sich von ihm biegen, drehen, heben, als wäre das ihre eigentliche Natur, und er weiß sie sicher zu halten und zu manövrieren, als gehöre sie wie ein weiteres Körperteil zu ihm.
Dass Jim und Laura Rose ein schönes Paar abgeben, sehen auch andere.

Wie eine Collage zeigt das Programmheft einige der schönsten Momente zwischen Jim (Christopher Evans) und Laura Rose (Alina Cojocaru) und die Schlussszene von „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier. Fotos: Kiran West / Faksimile: Gisela Sonnenburg
Amanda hofft, die beiden zu verkuppeln. Sie lädt Jim ein, nachdem sie Tom eingebläut hat, dass er für einen Ernährer seiner Schwester sorgen solle.
Die Tischdecke und die weißen Kleider der Frauen verbreiten festliches Flair und frohe Erwartung.
Aber das Gewitter, das der Besuchsszene voran geht, ist bereits eine Warnung. Prompt prasselt aus dem Off auch noch lange der Regen – und unterlegt die modern-leichte Musik von Ned Roram wie eine konterkarierende akustische Zutat.
Jim, der ersehnte Besucher, kommt. Er ist bestens gelaunt, und alles scheint zunächst zum Besten bestellt.
Nach exzellenten Tänzen der Anwesenden miteinander, in denen jeder Part seine eigenen Hoffnungen formuliert und vor allem Jim durch flotte Soli als flexibler Tanzpartner mitreißt, platzt das harmonische Beisammensein aber abrupt: Es klopft an der Tür, und Jims quietschfidele Verlobte Betty (köstlich spritzig: Priscilla Tselikova) stürmt herein. Laura Rose kann Jim nur noch das Einhorn, das er beim Tanzen zerbrach, mit auf die Reise ins Eheglück geben.
Das Einhorn ohne Horn sei ja jetzt wie alle anderen Pferde, also fühle es sich nicht mehr so allein, sagt Laura im Drama, als Jim den Schaden entdeckt. Als er für immer geht, ist das Einhorn ohne Horn für sie keine gute Erinnerung mehr.
Laura Rose bleibt traurig allein zurück, denn auch Tom verlässt die Familie. Er kann als Mann seiner Neigung nachgehen und sich als Künstler versuchen. Laura Rose sucht Trost bei Kerzenlicht, und hinter ihr taucht, wie ein Schutzengel, Tennessee, auf.
Die Kerzen der Erinnerung werden schwächer, bis Laura Rose sie ausbläst. Wenigstens die Dämonen der Vergangenheit können beherrscht werden – denen der Zukunft aber muss man sich stellen.

Laura Rose (Alina Cojocaru) sucht Trost bei Kerzenschein. So zu sehen in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier. Foto: Kiran West
Dieses Ende beeindruckt, rührt und hat jenen unabweisbaren Charme, den in den 80er-Jahren so manche Sprechtheater- oder Performance-Aufführung hatte. Ein Niveau, das man bewahren muss – und eine Formensprache, die der Bühne nie verloren gehen sollte.
Bei der Hauptprobe, während der die Fotos hier entstanden, war es übrigens noch ein fünfarmiger Kerzenleuchter, der die Welt für Laura Rose erträglich macht. Bei der Premiere dann genügen drei Kerzen, um diese Wirkung zu haben – zu prächtig wirkt der Fünfarmer, denn tatsächlich sind die Verhältnisse, in denen diese zerbrechende Familie Wingfield lebt, recht bescheiden.
Die Armut und der Zwang, der von ihr ausgeht, bilden denn auch eine unsichtbare, aber immer spürbare Folie für das Bühnengeschehen.
Als Gegenwelten fungieren die öffentlichen Bereiche des Lebens: Die Gay Bar, das wuselige Straßenleben mit tänzerisch fantastisch „flippigen“ und doch sichtlich gequälten Menschen, die Traumfabrik vom Kino, der massenerheiternde Sport (mit einem top getanzten Basketball-Spiel) und – nicht zu vergessen – die Revue.

Traumtänze unter Lampions: Die Gentleman Callers in Sommeranzügen entstammen den Erinnerungen von Amanda… so in „Die Glasmenagerie“ von John Neumeier. Foto: Kiran West
Hier sieht man dann, was man vielleicht in einem Ballett so gar nicht erwarten würde: die besten nur denkbaren Revuegirls.
Olivia Betteridge, Francesca Harvey, Xue Lin, Hayley Page und Priscilla Tselikova bilden ein kleines Meisterwerk in einem großen Meisterwerk, sie vereinen alle klassischen Kompetenzen mit dem Spaß an aufheiternder, schalkhafter und – oh ja – erotischer Darbietung.
In goldglitzernden Outfits mit Federn auf dem Zylinder bilden sie eine „Line“ vom Feinsten, und sie verströmen soviel appetitliches Flair und doch lebendige Kunstfertigkeit, dass man sofort ein abendfüllendes Programm mit ihnen möchte. Endlich mal Revuegirls, die ohne Sexismus in Szene gesetzt sind! Leider hat Neumeier bisher nichts für den Friedrichstadtpalast in Berlin inszeniert und wird dazu wohl auch in absehbarer Zeit nicht die Zeit finden.
Aber wenn Emilie Mazon als Tüpfelchen auf dem „i“ in schwarzglitzernder Montur auftaucht und mit den Goldmädels Revue und Spitzentanz vereint, dann spätestens weiß man, dass man sich „Die Glasmenagerie“ mindestens zwei Mal ansehen muss.
Denn das Traumweltenecho, das Neumeiers Ballettkammerspiel in einem auslöst, geht über bloße Begeisterung weit hinaus.
P.S. Aus Gründen, die noch erforscht werden, übersah Google nach mehr als 15 Stunden plötzlich die erste Ausgabe dieses Beitrags, Darum hiermit die zweite.
Gisela Sonnenburg

Unterstützen Sie das Ballett-Journal! Spenden! Kein Medium in Deutschland widmet sich so stark dem Ballett und bestimmten kulturellen Werten wie das Ballett-Journal. Sagen Sie dazu nicht Nein. Zeigen Sie, dass Sie das honorieren! Und freuen Sie sich über mehr als 600 Beiträge, die Sie hier finden – einige davon stets aktuell gelistet im „Spielplan“ hier im Ballett-Journal. Wir danken Ihnen von Herzen!